Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie/068
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie | |
| Inhalt | |
| Vorwort | Einleitung Erster Theil: Kap. 1 • 2 • 3 • 4 Zweiter Theil: Kap. 1 • 2 • 3 • 4 Dritter Theil: Kap. 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 | |
| <<<Vorherige Seite [067] |
Nächste Seite>>> [069] |
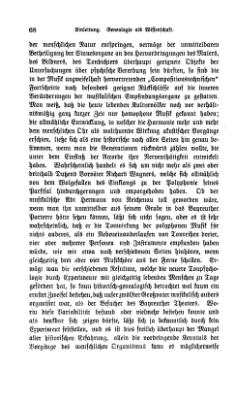 | |
| Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
| Texterfassung: korrigiert | |
| Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
| |
der menschlichen Natur entspringen, vermöge der unmittelbaren Betheiligung der Sinnesorgane an den Hervorbringungen des Malers, des Bildners, des Tondichters überhaupt geeignete Objekte der Untersuchungen über psychische Vererbung sein dürften, so sind die in der Musik unzweifelhaft hervortretenden „Compositionstechnischen“ Fortschritte noch besonders geeignet Rückschlüsse auf die inneren Veränderungen der musikalischen Empfindungsorgane zu gestatten. Man weiß, daß die heute lebenden Kulturvölker noch vor verhältnismäßig ganz kurzer Zeit nur homophone Musik gekannt haben; die allmähliche Entwicklung, in welcher die Harmonie mehr und mehr dem menschlichen Ohr als wolthuende Wirkung akustischer Vorgänge erschien, ließe sich als eine historische nach allen Seiten hin genau bestimmen, wenn man die Generationen rückwärts zählen wollte, die unter dem Einfluß der Accorde ihre Nerventhätigkeit entwickelt haben. Wahrscheinlich handelt es sich um nicht mehr als zwei oder dritthalb Dutzend Vorväter Richard Wagners, welche sich allmählich von dem Wolgefallen des Einklangs zu der Polyphonie seines Parsifal hindurchgerungen und emporgehoben haben. Ob der musikalische Abt Hermann von Reichenau toll geworden wäre, wenn man ihn unmittelbar aus seinem Grabe in das Bayreuther Parterre hätte setzen können, läßt sich nicht sagen, aber es ist sehr wahrscheinlich, daß er die Tonwirkung der polyphonen Musik für nichts anderes, als ein Nebeneinanderlaufen von Tonreihen dreier, vier oder mehrerer Personen und Instrumente empfunden haben würde, wie wir etwa nach verschiedenen Seiten hinhören, wenn gleichzeitig drei oder vier Musikchöre aus der Ferne schallen. Erwägt man die verschiedenen Resultate, welche die neuere Tonpsychologie durch Experimente mit gleichzeitig lebenden Menschen zu Tage gefördert hat, so kann historisch-genealogisch betrachtet wol kaum ein ernster Zweifel bestehen, daß unser zwölfter Großvater musikalisch anders organisirt war, als der Besucher des Bayreuther Theaters. Worin diese Variabilität bestand oder vielmehr bestehen konnte und als denkbar sich zeigen dürfte, läßt sich ja bekanntlich durch kein Experiment feststellen, und es ist dies freilich überhaupt der Mangel aller historischen Erfahrung, allein die vordringende Kenntnis der Vorgänge des menschlichen Organismus kann es möglicherweise