Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte/1/319
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte | |
| Register | 2. Band | 3. Band | 4. Band | |
| 1. Band | Inhalt des 1. Bandes | |
| <<<Vorherige Seite [318] |
Nächste Seite>>> [320] |
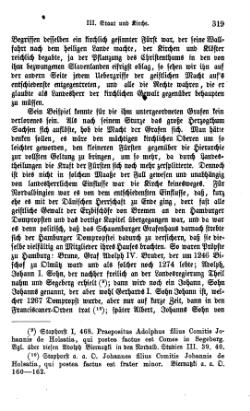
| |
| korrigiert | |
| Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
| |
Begriffen desselben ein kirchlich gesinnter Fürst war, der seine Wallfahrt nach dem heiligen Lande machte, der Kirchen und Klöster reichlich begabte, ja der Pflanzung des Christenthums in den von ihm bezwungenen Slavenlanden eifrigst oblag, so sehen wir ihn auf der andern Seite jedem Uebergriffe der geistlichen Macht auf's entschiedenste entgegentreten, und alle die Rechte wahren, die er glaubte als Landesherr der kirchlichen Gewalt gegenüber behaupten zu müssen.
Sein Beispiel konnte für die ihm untergeordneten Grafen kein verlorenes sein. Als nach seinem Sturze das große Herzogthum Sachsen sich auflöste, hob die Macht der Grafen sich. Man hätte denken sollen, es wäre den mächtigen kirchlichen Oberen um so leichter geworden, den kleineren Fürsten gegenüber die Hierarchie zur vollsten Geltung zu bringen, um so mehr, da durch Landestheilungen die Kraft der Fürsten sich noch mehr zersplitterte. Dennoch ist dies nicht in solchem Maaße der Fall gewesen und unabhängig von landesherrlichem Einflusse war die Kirche keinesweges. Für Nordalbingien war es von dem entschiedensten Einflusse, daß, kurz ehe es mit der Dänischen Herrschaft zu Ende ging, dort fast alle geistliche Gewalt der Erzbischöfe von Bremen an den Hamburger Dompropsten und das dortige Kapitel übergegangen war, und da war es denn politisch, daß das Schauenburger Grafenhaus darnach strebte sich der Hamburger Dompropstei dadurch zu versichern, daß sie dieselbe vielfältig an Mitglieder ihres Hauses brachten. So waren Pröpste zu Hamburg: Bruno, Graf Adolph IV. Bruder, der um 1246 Bischof zu Olmütz ward und als solcher noch 1274 lebte; Adolph, Johann I. Sohn, der nachher freilich an der Landesregierung Theil nahm und Segeberg erhielt ;[1] dann wird noch ein Johann, Sohn Johanns genannt, der aber wohl Gerhards I. Sohn Johann ist, welcher 1267 Dompropst wurde, aber nur auf kurze Zeit, dann in den Franciscaner-Orden trat ;[2] später Albert, Johanns Sohn von
- ↑ Staphorst I, 468. Praepositus Adolphus filius Comitis Johannis de Holsatia, qui postea factus est Comes in Segeberg. Vgl. über diesen Adolph Biernatzki in den Nordalb. Studien III. 39. 40.
- ↑ Staphorst a. a. O. Johannes filius Comitis Johannis de Holsatia, qui postea factus est frater minor. Biernatzki a. a. O. 160-162.